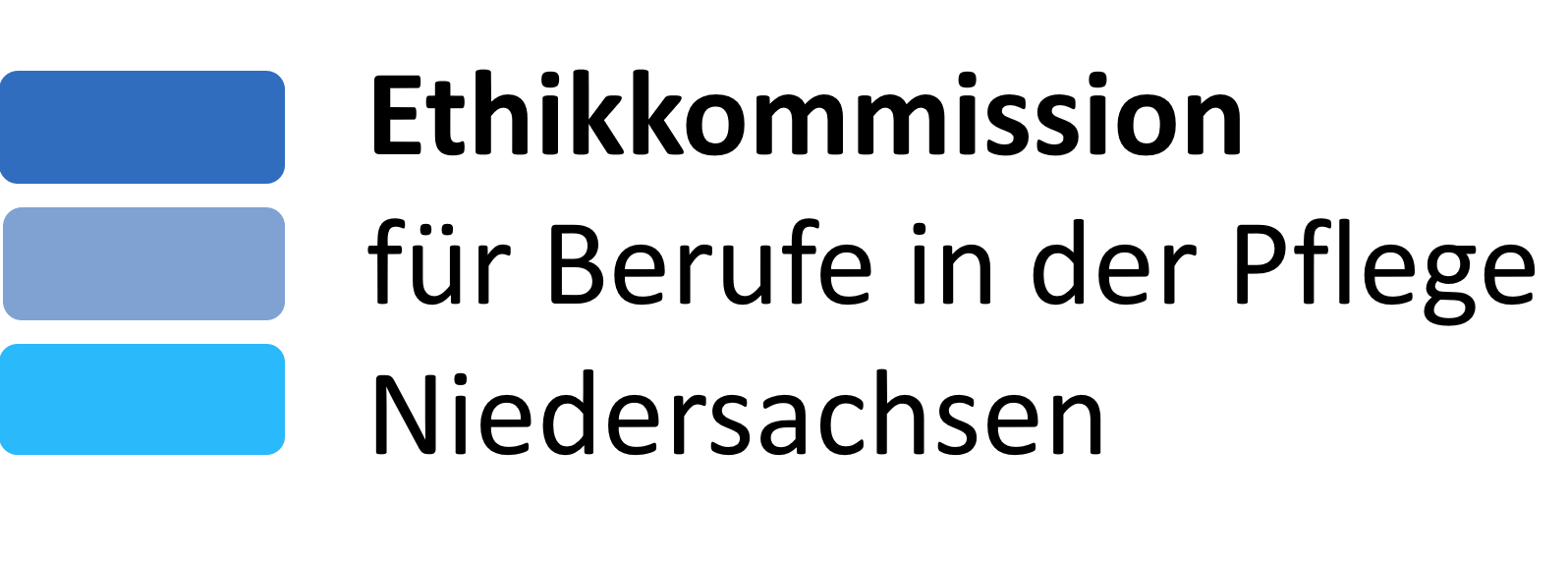Die Ethikkommission für Berufe in der Pflege veröffentlicht Anfragen, die ihr zur ethischen Beratung vorgelegt werden, sowie die von ihr erarbeiteten Antworten in anonymisierter Form. Vorausetzung dafür ist, dass von den anfragenden
Personen bzw. Organisationen kein Widerspruch gegen die Veröffentlichung eingelegt wurde.
Umgang mit stationär betreuten Menschen, die im Zustand akuter oder permanenter Desorientierung Abwehrreaktionen gegenüber Pflegehandlungen zeigen
Wie sollte mit stationär betreuten Menschen umgegangen werden, die im Zustand akuter oder permanenter Desorientierung, z.B. im Delir oder aufgrund einer Demenz, Abwehrreaktionen gegenüber Pflegehandlungen zeigen (z.B. beim Verbandswechsel, der Inkontinenzversorgung oder der Körperpflege)?
Jede pflegerische Maßnahme erfordert die Einwilligung der pflegebedürftigen Person, also ihre Zustimmung nach ausreichender Aufklärung. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die kognitiven Fähigkeiten zum Verstehen, Abwägen und Entscheiden bei pflegebedürftigen Personen mitunter vorübergehend oder dauerhaft eingeschränkt beziehungsweise aufgehoben sind. In solchen Situationen kann es geschehen, dass indizierte Pflegemaßnahmen abgelehnt oder aktiv abgewehrt werden. Ein solches Abwehrverhalten kann u. a. infolge von Desorientierung, mangelnder Impulskontrolle, Angst, Schmerzen, körperlicher Unruhe, Vergesslichkeit oder Frustration auftreten.
Der Umgang mit pflegebedürftigen Personen, die Abwehrverhalten zeigen, stellt Pflegefachpersonen vor ein ethisches Dilemma: Pflegerische Maßnahmen sind notwendig, um gesundheitliche Schäden zu vermeiden und den Genesungsprozess zu fördern. Werden diese Maßnahmen jedoch trotz der Abwehr der zu pflegenden Person erzwungen, kann dies deren Stress, körperliche Unruhe oder Angst erhöhen und ihr Selbstwertgefühl zusätzlich beeinträchtigen. Pflegefachpersonen stehen in solchen Situationen vor der Herausforderung, abzuwägen, inwieweit ein (kurzfristiges) Zurückstellen von Pflegemaßnahmen zum Schutz des unmittelbaren Wohlbefindens und der psychischen Stabilität der betroffenen Person ethisch vertretbar ist, ohne dabei langfristig Pflegestandards zu verletzen und einen defizitären Pflegezustand zu riskieren, der gesundheitliche Schäden (wie z. B. Infektionen, Hautschäden oder Verzögerungen bei der Wundheilung) nach sich ziehen kann.
Der Umgang mit Menschen, die in einem Zustand der Desorientierung, Angst, körperlicher Unruhe, mangelnder Impulskontrolle o. Ä. pflegerische Maßnahmen ablehnen oder abwehren, erfordert ein hohes Maß an pflegerischer Kompetenz (DNQO 2018), eine klare pflegeethische Haltung sowie organisationsethische Überlegungen. Insbesondere die folgenden Aspekte sollten dabei aus Sicht der Ethikkommission für Berufe in der Pflege grundsätzlich Beachtung finden:
- Eine akute Desorientierung ist eine ernstzunehmende Gesundheitsstörung und keine unvermeidliche Begleiterscheinung des Alterns. Die Auslöser sollten daher immer abgeklärt sein. Die Ermittlung der Ursachen für einen solchen Zustand ist wichtig, um angemessen mit Menschen mit Pflegebedarf umgehen zu können.
- Von zentraler Bedeutung ist die Anerkennung der Personalität von Menschen mit Pflegebedarf, auch wenn kognitive Einschränkungen die Kommunikation erschweren können (Ritzi, 2023, S. 149ff.). Mit Personalität ist in diesem Zusammenhang eine tiefgreifende Veränderung im Denken, Fühlen und Handeln der pflegebedürftigen Person gemeint, die oft zu ungewohntem oder als „herausfordernd“ bezeichnetem Verhalten (Linde/Riedel 2025) führt. Dieses Verhalten ist jedoch kein Ausdruck eines Verlusts der Persönlichkeit, sondern vielmehr Ausdruck der Erkrankung. Diese zeigt sich in Form von Desorientierung, Angst oder Überforderung und veranlasst die Betroffenen dazu, auf individuelle Weise zu kommunizieren und zu reagieren.
- Wenn pflegerische Maßnahmen abgewehrt werden, sollte deren Durchführung nicht forciert, sondern in einer emphatischen, ressourcenorientierten Weise angeboten werden, etwa durch eine ruhige, verständliche Ansprache und die Vermeidung bekannter Reize, die bei der betroffenen Person abwehrendes Verhalten auslösen können. Wenn die Situation die Durchführung von Pflegemaßnahmen zulässt, sollten Pflegefachpersonen diese langsam und achtsam vornehmen und den Blickkontakt mit den zu pflegenden Personen halten. Auf diese Weise kann Kooperation oft gefördert werden (Ritzi, 2023, S. 129f.).
- Zugleich ist es aus ethischer Sicht geboten, pflegerische Maßnahmen hinsichtlich ihrer Priorität kritisch zu reflektieren und ggf. anzupassen. Nicht jede pflegerische Maßnahme ist zu jedem Zeitpunkt unverzichtbar. So können bestimmte Pflegehandlungen – je nach Situation der zu pflegenden Person – etwa im Tagesablauf verschoben, in einem Stück durchgeführt oder auch in kleinere Schritte aufgeteilt werden, um die Belastung für die betroffene Person zu reduzieren.
- Wird seitens des Pflegeteams beschlossen, bei einer Person, die Abwehrverhalten zeigt, einzelne Pflegemaßnahmen nicht durchzuführen, muss dieses Vorgehen stets eine klare Handlungsstrategie beinhalten, wie und wann die zurückgestellten Pflegemaßnahmen nachgeholt werden können. Eine nachvollziehbare Dokumentation über verschobene oder abgebrochene Maßnahmen trägt dazu bei, das Vorgehen im Team abzustimmen sowie ggf. vorhandene rechtliche Vertreter:innen entsprechend zu informieren
Für die Planung und Durchführung pflegerischer Maßnahmen bei Personen, die Abwehrverhalten zeigen bzw. bei denen bekannt ist, dass ein solches Abwehrverhalten bereits aufgetreten ist, empfiehlt die Ethikkommission u. a. die Berücksichtigung folgender Aspekte im Sinne einer patientenzentrierten Pflege:
- Der Einbezug von An- und Zugehörigen kann ein stabilisierender Bestandteil der Versorgung sein. Vertraute Personen können Menschen mit Demenz oder im Delir unterstützen, Orientierung und Sicherheit vermitteln sowie die Zusammenarbeit mit dem Pflegeteam erleichtern.
- Das Pflegeteam sollte die Orientierung von Menschen mit Pflegebedarf fördern, indem sie eine räumliche und zeitliche Orientierung bieten. Dazu gehört neben der Information zum Wochentag, der Uhrzeit etc. auch, sich kontinuierlich mit Namen vorzustellen und ein Namensschild zu tragen. Die Anzahl der Bezugs- und Pflegepersonen sollte so weit wie möglich reduziert werden.
- Pflegemaßnahmen sollten möglichst in einen Zeitraum gelegt werden, in dem die betroffene Person größere Wachheit und Kooperationsbereitschaft zeigt. Dies setzt eine agile Umsetzung pflegerischer Tätigkeiten im Stationsablauf voraus.
- Die zu pflegende Person sollte aktiv in die Pflegemaßnahme einbezogen werden, indem die bevorstehenden Schritte angekündigt und erklärt werden. So kann die Person sich auf die bevorstehende Situation einstellen. Besonders bei pflegebedürftigen Personen, die (vorrübergehend) desorientiert sind, ist es entscheidend für die Wahrung und Stärkung ihrer Selbstbestimmung, zu eruieren, welche Vorbehalte gegenüber der betreffenden Pflegemaßnahme möglicherweise bestehen. Dies kann eine Atmosphäre von Anerkennung und Respekt schaffen und dazu beitragen, eine akut gereizte Situation zu entschärfen.
- Hinweise zu den bisher vorgenommenen Unterstützungsmaßnahmen, erfolgreichen Interventionsstrategien für die Vornahme von Pflegemaßnahmen sowie zu vorhandenen Ressourcen der Person sollten im Überleitungsbogen wertschätzend und informativ dargestellt werden. Die Beschreibung sollte sachlich, empathisch und ohne stigmatisierende Sprache erfolgen.
Zitierte Literatur:
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP) (2018). Expertenstandard. Beziehungsgestaltung in der Pflege von Menschen mit Demenz. https://www.dnqp.de/fileadmin/HSOS/Homepages/DNQP/Dateien/Expertenstandards/Demenz/Demenz_AV_Auszug.pdf
Linde, A.-C.; Riedel, A. (2025). Herausforderndes Verhalten. In: Riedel, A.; Linde A.-C. (Hrsg.), Ethische Reflexion in der Pflege. Berlin, Heidelberg: Springer.
Ritzi, S. (2023). Freiheitseinschränkende Maßnahmen bei Menschen mit Demenz in professionellen Sorgebeziehungen. Kritische Darstellung und ethisch-fachliche Reflexion. Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-39761-6
Ethische Vertetbarkeit des Einsatzes von GPS-Transpondern bei Menschen mit Demenz im stationären Setting
Ist der Einsatz von GPS-Transpondern, die es erlauben, Menschen mit Demenz im stationären Settingen zu orten, bzw. die ein Signal abgeben, wenn sich die betroffene Person aus einem digital abgegrenzten Bereich entfernt, ethisch vertretbar?
Die Anfrage bezieht sich auf die ethische Vertretbarkeit des Einsatzes von GPS-Transpondern bei Menschen mit Demenz in der stationären Langzeitversorgung. Durch die Sendung eines dauerhaften Signals kann der Standort von Menschen mit Demenz, die orientierungslos sind, von einer Bezugsperson nachvollzogen werden. Viele Systeme erlauben die Festlegung eines definierten Sicherheitsbereichs (sogenannter „Geofence“); dies kann z. B. der Garten einer Einrichtung der stationären Langzeitversorgung sein. Wenn sich eine mit einem GPS-Transponder ausgestattete Person aus dem definierten Bereich entfernt, wird ein Alarm ausgelöst und eine Meldung als Push-Nachrichten oder SMS an hinterlegte Kontakte gesendet.
GPS (Global Positioning System) ist ein globales Ortungssystem, das mithilfe von Satellitensignalen die genaue Position von Objekten oder Personen bestimmen kann. GPS-Ortungssysteme können von Menschen, die orientierungslos und verwirrt sind oder eine Hin- bzw. Weglauftendenz aufweisen, in Form von Transpondern am Körper getragen werden (z. B. als Armband, Kette, Schlüsselanhänger oder Uhr). Eine Applikation (App) auf dem Smartphone oder Computer ermöglicht es Bezugspersonen oder Mitarbeitenden der Einrichtung zu verfolgen, wo sich die betreffende Person befindet. Einige GPS-Transponder lassen sich auch mit einem Notruf-System koppeln.
Die Frage nach dem Einsatz von GPS-Transpondern bei Menschen, die aufgrund einer Demenz oder anderer kognitiver Einschränkungen orientierungslos sind, betrifft ein grundsätzliches ethisches Spannungsfeld: die Abwägung zwischen professioneller Fürsorgepflicht und dem Respekt vor der Autonomie sowie den Persönlichkeitsrechten der betroffenen Personen. Für die pflegerische Praxis besteht die Herausforderung darin, ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz vor Gefahren und dem Erhalt von Selbstbestimmung zu schaffen. Einerseits können GPS-Transponder die Sicherheit und das Wohlbefinden für orientierungslose Menschen erhöhen, indem sie sich freier auf dem Gelände der Einrichtung und deren Umgebung bewegen können. Gleichzeitig wird das Pflegepersonal dabei unterstützt, seiner Verantwortung für diese vulnerable Personengruppe gerecht zu werden. So ermöglichen GPS-Transponder, ein rasches Auffinden orientierungsloser Personen ohne aufwendigen Personaleinsatz oder gar die Involvierung der Polizei. Werden orientierungslose Personen ohne großen Zeitverzug aufgefunden und in für sie sichere Bereiche zurückgeführt, kann sie dies zudem vor Verletzungen (z.B. Dehydrierung, Erfrierungen) bewahren.
Andererseits geht der Einsatz von GPS-Transpondern mit einer fortlaufenden Ortung einher, die die Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre der Betroffenen einschränken kann. Besonders problematisch ist dabei, dass Menschen mit Demenz oft nicht mehr in der Lage sind, dem Einsatz von GPS-Transpondern selbstständig zuzustimmen bzw. diesen abzulehnen. Gleichwohl kann die Nutzung von GPS-Transpondern auch zur Förderung der Autonomie betroffener Personen beitragen, indem sie deren Bewegungsfreiheit erhöhen und ihnen z. B. Spaziergänge ohne Angst vor dem Verlaufen ermöglichen.
Dieses Spannungsfeld kann zu einem ethischen Dilemma für Pflegefachpersonen und Einrichtungen führen: Konkret gilt es für sie abzuwägen, wie weit der Eingriff in die Autonomie gerechtfertigt ist, um Schutz und Sicherheit für Menschen mit Demenz zu gewährleisten, ohne deren Würde und persönlichen Rechte zu beeinträchtigen. Dabei kann nicht pauschal vorgegangen werden, sondern jeder Einzelfall ist gesondert zu betrachten. Ähnlich gelagerte Situationen können durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.
Bevor konkrete Empfehlungen für die ethische Abwägung vorgestellt werden, weist die Ethikkommission für Berufe in der Pflege darauf hin, dass bei der Entscheidungsfindung in jedem Fall auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz GPS-gestützter Ortungssysteme bei dementen oder aus anderen Gründen orientierungslosen Personen zu berücksichtigen sind:
- Die Anbringung eines GPS-Transponders bedarf grundsätzlich der Zustimmung/Einwilligung der betroffenen Personen. Sind diese nicht in der Lage, selbst wirksam zuzustimmen, weil sie krankheitsbedingt die Bedeutung eines GPS-Transponders nicht zu ermessen vermögen (Einwilligungsunfähigkeit), ist seitens der Einrichtung die Zustimmung der rechtlichen Vertretung einzuholen. Die rechtliche Vertretung kann entweder der/die Bevollmächtigte übernehmen oder – wenn keine Vollmacht vorliegt – der/die rechtliche Betreuer:in mit dem Aufgabenbereich „Gesundheitssorge/ Aufenthaltsbestimmung“.
- Im Einzelfall kann die rechtliche Vertretung verpflichtet sein, eine Genehmigung des Betreuungsgerichts für die Anbringung des GPS-Transponders zu beantragen (§ 1831 Abs.1/ Abs. 4 BGB). Ob dies erforderlich ist, hängt davon ab, mit welchem Ziel der GPS-Transponder bei einer einwilligungsunfähigen Person zur Anwendung gelangt. Soll der Transponder der Einrichtung ermöglichen, den/die Bewohner:in auf seinem/ihrem Gang nach draußen zu begleiten, damit dieser/diese auch wieder zurückfindet, wenn er/sie nach Hause möchte, bedarf es für dessen Anbringung keiner zusätzlichen gerichtlichen Genehmigung. In diesem Fall wird der Transponder genutzt, um Bewohner:innen mit kognitiven Einschränkungen in ihrem Freiheits- und Bewegungsdrang zu unterstützen, d. h. deren Freiheit wird erweitert und nicht eingeschränkt. Soll der Transponder hingegen den Mitarbeitenden der Einrichtung ermöglichen, den/die einwilligungsunfähige:n Bewohner:in gegen seinen/ihren geäußerten Willen am Verlassen der Einrichtung zu hindern oder gegen seinen/ihren geäußerten Willen zurück in die Einrichtung zu bringen, liegt eine freiheitsentziehende Maßnahme bzw. eine freiheitsentziehende Unterbringung vor. In diesem Fall ist neben der Zustimmung der rechtlichen Vertretung auch eine gerichtliche Genehmigung durch das Amtsgericht erforderlich.
Aus Sicht der Ethikkommission für Berufe in der Pflege sind GPS-Transponder zur Ortung von Menschen, die aufgrund einer Demenz oder anderen kognitiven Einschränkungen in ihrer Orientierung eingeschränkt sind, in ethischer Hinsicht nicht grundsätzlich abzulehnen; sie erfordern jedoch eine sorgfältige Reflexion sowie eine klare und transparente Orientierung an den Bedürfnissen und Rechten der Betroffenen. Um das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Selbstbestimmung verantwortungsvoll zu gestalten, möchte die Ethikkommission insbesondere die folgenden Aspekte für eine ethisch reflektierte Entscheidungsfindung betonen:
- Grundsätzlich gilt es in jedem Fall abzuwägen, ob der Nutzen einer GPS-Ortung die Einschränkung der persönlichen Freiheit überwiegt. In diesem Zusammenhang sollte regelhaft geprüft werden, ob es weniger restriktive Alternativen gibt, die den Schutz der betroffenen Person ebenfalls gewährleisten, z. B. Klingelmatte oder Signal beim Öffnen einer Tür.
- Insofern der Einsatz von GPS-Transpondern mit Einschränkungen der individuellen Privatsphäre einhergeht, sollte das Ausmaß der Ortung und ggf. Überwachung auf das notwendige Minimum begrenzt werden. Eine ethisch vertretbare Lösung setzt voraus, dass der Einsatz tatsächlich zu einem Mehrwert an Unabhängigkeit führt und von Pflegefachpersonen auch so beobachtet werden kann.
- Zu beachten ist, dass für die Anwendung von GPS-Transpondern eine konkrete, drohende Gesundheitsgefährdung vorliegen muss und eine Zustimmung erforderlich ist, da der Einsatz einen erheblichen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte darstellen kann.
- Die Zustimmung zur Nutzung eines GPS-Transponders sollte freiwillig erfolgen, solange die Person noch einwilligungsfähig ist, und idealerweise in einer Vorausverfügung festgehalten werden. Sinnvoll wäre es zudem, Fragen zur Anwendung von Ortungsmaßnahmen bereits zu Beginn einer Demenzerkrankung, bei noch (teilweise) erhaltener Einwilligungsfähigkeit, standardmäßig in die gesundheitliche Vorsorgeplanung zu integrieren.
- Im Falle der Einwilligungsunfähigkeit ist die Einbindung der rechtlichen Vertretung bezüglich des Einsatzes eines GPS-Transponders erforderlich, um den mutmaßlichen Willen zu ermitteln.
- Im Rahmen von Pflegeeinrichtungen sind darüber hinaus klare Kriterien und Rahmenbedingungen für den Einsatz von GPS-Transpondern zu definieren und festzulegen, unter welchen Bedingungen diese beispielsweise zum Einsatz kommen, wie dieser dokumentiert und transparent gegenüber allen Beteiligten kommuniziert wird. Dabei müssen selbstverständlich die rechtlichen Vertreter:innen in diesem Prozess mitbedacht und entsprechend einbezogen werden.
Balance von Empathie/Zuwendung und professioneller Distanz im Umgang mit pflegebedürftigen Menschen in der ambulanten und stationären Langzeitversorgung
Die Anfrage thematisiert die Gratwanderung von Mitarbeitenden in der Pflege untereinander und im Umgang mit Klient:nnen/Patient:innen/Bewohnenden zwischen Emphatie/Zuwendung und professioneller Distanz im Kontext der ambulanten und stationären Langzeitpflege. Zur Diskussion wird der vermeintlich erfolgreiche persönliche Umgang von Mitarbeitenden der Pflege mit Klient:innen/Patient:innen gestellt. So wird etwa das Duzen oder Ansprechen mit Vornamen oder Namensverniedlichungen, wie angehängte „ies“ an den Nachnamen, nicht selten als empathischer Zugang bzw. als ein Mittel des Beziehungsaufbaus angesehen und sind in der Wahrnehmung der Beteiligten oft positiv besetzt. Schilderungen der persönlichen Lebenssituation von Mitarbeitenden (Kinder-, Finanzprobleme, Trennung/Scheidung) können zu Begrifflichkeiten wie „Vertrauensverhältnis“ und „persönliche Freundschaft“ mit Klient:innen/Bewohnenden führen. Auch kommt es vor, dass mit diesen über andere Mitarbeitende und deren private Lebenssituation gesprochen wird. Die Suche nach Beziehungsindividualität in institutionellen Zusammenhängen hat eine hohe ethisch-moralische Komponente und korrespondiert mit Problemen wie Vereinzelung und Einsamkeitswahrnehmung. Dahinter steht als strukturelle Frage im Raum, wie Mitarbeitende in der Pflege auf ihre Rolle und Funktion vorbereitet werden und inwieweit Gesprächsführung, Abgrenzung und professionelle Distanz mit Freundlichkeit und Zugewandtheit in Aus- und Fortbildungen verpflichtend vermittelt werden/werden können.
Die von Frage nach der Balance von Empathie/Zuwendung und professioneller Distanz im Umgang mit pflegebedürftigen Menschen ist im Kontext der stationären und/oder ambulanten Langzeitversorgung aus Sicht der Ethikkommission für Berufe in der Pflege von besonderer ethischer Brisanz. Aus ethischer Perspektive befinden sich Pflegende (mit unterschiedlichen Qualifikationsniveaus und Kompetenzstufen) in einem grundlegenden Spannungsfeld: Sie müssen einerseits Nähe zu den Pflegebedürftigen aufbauen und zugleich die notwendige professionelle Distanz in der Pflegebeziehung wahren.
Die Begriffe Nähe und Distanz in der Pflege beschreiben das emotionale, räumliche und soziale Verhältnis zwischen Pflegepersonal und Menschen mit Pflegebedarf. Emotionale Nähe steht für Zugehörigkeit, Vertrauen, Sympathie, Akzeptanz und Mitgefühl. Distanz hingegen ermöglicht Schutz vor physischen und psychischen Verletzungen sowie die Wahrung einer professionellen Objektivität. Empathie und persönliche Zuwendung sind einerseits wesentliche Bestandteile professioneller Pflege, da sie Vertrauen schaffen, soziale Isolation mindern und schließlich die Würde der zu Pflegenden wahren. Andererseits kann eine zu große persönliche Nähe dazu führen, dass Grenzen verschwimmen: Pflegebedürftige könnten die Beziehung als Freundschaft missverstehen, wodurch aufgrund der in der Pflegebeziehung angelegten Asymmetrie Abhängigkeiten entstehen können; Pflegende geraten in Gefahr, ihre Rolle zu überschreiten, z. B. durch private Offenbarungen oder das Annehmen von Geschenken. Auch werden durch einen solchen Umgang Strukturen von Professionalität und Fairness im Pflegeteam untergraben. Dies kann zu „Klatsch“, Bevorzugungen/Benachteiligungen sowie damit verbundenen Konflikten führen.
Aus Sicht der Ethikkommission für Berufe in der Pflege verdichtet sich das ethische Kernproblem somit zu der praktischen Frage, wie eine menschlich zugewandte und vertrauensvolle Beziehung zwischen Pflegenden und Menschen mit Pflegebedarf konkret gestaltet werden kann, so dass diese weder in eine unprofessionelle, die Selbstbestimmung und den Schutz von Menschen mit Pflegebedarf gefährdende Nähe kippt, noch deren Bedürfnis nach Nähe und Beziehung übergeht.
Um einen entsprechend würdevollen Umgang mit pflegebedürftigen Menschen sicherzustellen, empfiehlt die Ethikkommission die Berücksichtigung folgender Aspekte:
- Es liegt in der Verantwortung der Einrichtungen bzw. Anbieter professioneller Pflege, ihre Mitarbeitenden – unabhängig von deren Qualifikationsniveau und Kompetenzstufe – auf diese Grenzsituationen in der Pflegebeziehung vorzubereiten, sie für deren ethische Dimension zu sensibilisieren und verbindliche Standards für Selbstreflexion, Gesprächsführung und Abgrenzung zu etablieren.
- Einrichtungen des Gesundheitswesens sollten ihre Mitarbeitenden dabei unterstützen, eine offene, wertschätzende Zusammenarbeit sowie eine angemessene und professionelle Kommunikation im Team zu pflegen. Vonseiten der Pflegeeinrichtung sollten für die Mitarbeitenden verbindliche (ggf. verpflichtende) Module zu Kommunikation, Ethik und professioneller Beziehungsgestaltung angeboten werden, um schädlichen, professionell unangemessenen Dynamiken im Pflegeteam entgegenzuwirken.
- Beruflich Pflegende tragen gleichwohl eine persönliche Verantwortung für die professionelle Gestaltung der Beziehung zu Menschen mit Pflegebedarf. So gehört es, laut ICN-Ethikkodex, zu den Pflichten von Pflegefachpersonen, die Grenzen ihrer beruflichen Rolle zu erkennen und zu berücksichtigen. Pflegepersonen müssen sich entsprechend regelmäßig mit ihrem eigenen Nähe-Distanz-Verhalten auseinandersetzen; dies sollte durch Supervision, Fallbesprechungen oder die Reflexion von schwierigen Nähe-Distanz-Situationen im Team unterstützt werden.
- Professionell Pflegende sollen Empathie gegenüber allen Menschen mit Pflegebedarf zeigen. Dazu gehören vor allem aktives Zuhören und echte Präsenz – jedoch ohne intime Details aus dem eigenen Privatleben preiszugeben oder persönliche Probleme zu teilen. Pflegende sollen ihre Wertschätzung gegenüber Menschen mit Pflegebedarf über eine respektvolle Sprache vermitteln, nicht durch Verniedlichungen oder „Pseudofreundschaften“.
- Die Herstellung von Nähe in der Pflegebeziehung kann durchaus bedeuten, dass Pflegende Inhalte aus dem eigenen Leben in Gespräche aufnehmen. Entscheidend ist dabei jedoch eine „gesunde“ Selbstreflexion. So sollten sich Pflegende stets darüber bewusst sein, dass sie in der professionellen Rolle einer Pflegeperson handeln und nicht als private Freundin/Vertraute. Werden die Grenzen dieser professionellen Rolle – etwa durch Fragen oder Kommentare zum Privatleben – von Menschen mit Pflegebedarf überschritten, sind Pflegende gefordert, freundlich, aber bestimmt auf die Wahrung dieser Grenzen hinzuweisen.
- Einrichtungen sollten über klare Regeln zum Umgang mit privater Offenheit und Anredeformen verfügen (z. B. „Duzen“ nur nach Absprache und mit Zustimmung der Einrichtung) und diese transparent kommunizieren.
- Werden Pflegenden Geschenke von Menschen mit Pflegebedarf angeboten, sollten sie sich zwar dankbar zeigen, die Annahme jedoch höflich ablehnen. Um solche Situationen im Rahmen der individuellen Pflegebeziehung zu vermeiden, sollten seitens der Pflegeeinrichtung mit Menschen mit Pflegebedarf sowie den Mitarbeitenden klare Regeln zum Umgang mit Geschenken vereinbart werden, z. B. eine Überführung in institutionelle Strukturen (etwa eine gemeinsame Kaffeekasse oder eine Einrichtungsspende; die Erstellung eines Compliance-Leitfadens kann zur Darstellung korrekten Verhaltens hilfreich sein).
- Auf struktureller Ebene sollten Pflegeethik sowie damit verbundene, pflegerische Themen, wie
z. B. das Spannungsfeld von Nähe und Distanz, verbindlich in einrichtungsweite Schulungen, Weiterbildungen und Teambuilding-Maßnahmen integriert werden, um Pflege- und Betreuungspersonal in der Gesprächsführung und Selbstreflexion zu stärken. - Die Etablierung von Ethikforen und/oder Ethik-Cafés in Einrichtungen bietet sich an, um sich mit bestehenden Ethikstrukturen anderer Einrichtungen zu vernetzen und Pflegenden grundsätzlich eine Ansprechstelle für ethische Grenzfragen und Konflikte in ihrer beruflichen Praxis zu eröffnen.
Weiterbeatmung von in der neurologischen Langzeitpflege verstorbenen Patient:innen
In der neurologischen Langzeitpflege verstorbene Patient:innen werden bis zur ärztlichen Todesfeststellung weiterbeatmet, was mitunter Stunden dauern kann. Ein solches Vorgehen erscheint sowohl aus professioneller Sicht als auch mit Blick auf die Würde der Verstorbenen als problematisch. Viele beruflich Pflegende, die in diesen Bereichen tätig sind, fühlen sich zu diesem Thema wenig informiert und unterstützt.
Pflegefachpersonen erleben solche Situationen als ein ethisches Dilemma: Aufgrund von Erfahrung und Monitoring können sie den Tod von Patient:innen/Bewohner:innen erkennen und empfinden es als würdeverletzend – sowohl für die Patient*innen/Bewohner:innen als auch für die beruflich Pflegenden –, die Beatmung bei bereits Verstorbenen fortzusetzen. Andererseits ist es rechtlich vorgegeben, dass nur approbierte Ärzt:innen den Tod offiziell feststellen dürfen. Selbst wenn sie es könnten, haben Pflegefachpersonen keine Befugnis zur Todesfeststellung. Aus rechtlicher Sicht ist eine Weiterbeatmung bis zur ärztlich durchgeführten Leichenschau somit erforderlich. Für Pflegefachpersonen verursachen Situationen, in denen verstorbene Patient:innen weiterbeatmet werden, moralischen Stress. Konkret stehen sie vor der Herausforderung, im Einzelfall eine Balance zu finden zwischen ihrer berufsethischen Verantwortung, ein würdiges Sterben zu unterstützen sowie die Autonomie von Patient:innen am Lebensende zu achten, und der Pflicht, rechtliche Vorgaben einzuhalten.
Für den Umgang mit solchen Situationen möchte die Ethikkommission für Berufe in der Pflege die folgenden Aspekte zu bedenken geben und dabei insbesondere auf die Bedeutung proaktiver interprofessioneller Kommunikation zur Vermeidung ethisch herausfordernder Situationen im Umgang mit verstorbenen Patient:innen/Bewohner:innen hinweisen:
- Pflegefachpersonen sollten Kenntnis darüber haben, dass es die Pflicht von Ärzt:innen ist, unverzüglich nach Benachrichtigung über einen Todesfall (d. h. ohne schuldhaftes Verzögern) zu Patient:innen zu kommen, um deren Tod festzustellen (§§ 3, 4 Abs. 1 S.1 Nds. BestattG). Es kann ggf. zur Verhängung eines Bußgeldes kommen. Wenn Ärzt:innen ihre Pflichten im Rahmen der Leichenschau verletzen ist ggf. auch eine Meldung bei der Landesärztekammer Niedersachen möglich.
- Grundsätzlich ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Team zwischen Ärzt:innen und beruflich Pflegenden wichtig, um den Pflegefachpersonen in solchen Situationen Sicherheit zu geben. Dies setzt eine patientenzentrierte Versorgung als gemeinsames Ziel von Ärzt:innen und Pflegefachpersonen voraus. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erfordert zudem wechselseitige Verlässlichkeit, die beinhaltet, dass Vereinbarungen eingehalten werden und Verantwortung für das eigene Handeln übernommen wird. Schließlich braucht es Ehrlichkeit, um Probleme oder Fehler im interprofessionellen Team offen anzusprechen. Diese Qualität der Zusammenarbeit ist zentral, um mit ethisch herausfordernden Situationen professionell umzugehen und die Entstehung von moralischem Stress zu vermeiden.
- Pflegefachpersonen sollten darin bestärkt werden, proaktiv auf Ärzt:innen zuzugehen und regelmäßig die Indikation für therapeutische Maßnahmen (z. B. invasive Beatmung) zu hinterfragen. Dies kann ggf. zur Vermeidung von Situationen beitragen, in denen Patient:innen unter Beatmung versterben.
- Bei Verdacht auf Gesetzesverstöße, vermuteten Pflegefehlern oder pflegerischen Qualitätsmängeln können sich beruflich Pflegende aus allen Pflegebereichen an die Beschwerdestelle Pflege beim Sozialministerium in Hannover wenden.
Transpersonen ohne vollständig Transition – Zimmerbelegung im stationären Setting
Wie kann eine Zimmerbelegung von Transpersonen ohne vollständige Transition im stationären Setting erfolgen?
Die Frage, wie eine Zimmerbelegung von Trans*Personen ohne vollständige Transition im stationären Setting umgesetzt werden kann, hat eine grundsätzliche ethische Dimension, da sie sowohl die Selbstbestimmung von Trans*Patient:innen als auch die anderer Patient*innen berührt. Vor dem Hintergrund, dass Pflegefachpersonen für die stationäre Bettenbelegung verantwortlich sind, ist Ihre Frage zudem von unmittelbarer pflegeethischer Bedeutung. So gilt es im Umgang mit dieser Situation, sowohl die Intimsphäre von Trans* Patient:innen, die noch keine Transition zu dem Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren, durchlaufen haben, als auch die Intimsphäre anderer Patient:innen, die sich mit dem Geschlecht, das ihnen anhand ihrer angeborenen Körpermerkmale zugeschrieben wurde, identifizieren (Cis*Patient:innen), zu wahren.
Grundsätzlich möchte die Ethikkommission für Berufe in der Pflege betonen, dass das Geschlecht, zu dem sich eine Person zugehörig fühlt und mit dem sie sich identifiziert, unbedingte Anerkennung im Pflegeprozess finden muss. Eine diversitätssensible Pflege, die die Wünsche von Patient*innen auch mit Blick auf ihre geschlechtliche Identität respektiert, ist Teil des pflegerischen Ethos, das die Achtung der Patientenautonomie als einen zentralen Wert beinhaltet. Der Suche nach einer die Autonomie von Trans* Personen respektierenden Lösung stehen gesetzliche Vorgaben nicht entgegen.
Um sowohl eine würdevolle stationäre Unterbringung von Trans*Patient:innen ohne vollständige Transition als auch von Cis*Patient:innnen sicherzustellen,empfiehlt die Ethikkommission für Berufe in der Pflege konkret folgende Maßnahmen:
- Pflegefachpersonen kommunizieren offen, sowohl mit Trans*Patient:innen als auch mit den Patient:innen, mit denen diese. das Zimmer teilen würden. Dazu gehört es auch, Trans*Patient:innen auf mögliche Unsicherheiten (z. B. bezüglich der bevorzugten Anrede) anzusprechen und mit ihnen zu besprechen, ob sie lieber in einem Einzelzimmer untergebracht werden möchten. Eine der Identität der Trans*Person zuwiderlaufende geschlechtliche Zuordnung (z.B. durch eine nicht gewünschte Anrede oder eine Zimmerbelegung mit Patient:innen anderen Geschlechts als dem, mit dem sich die Trans*Person identifiziert) kann von diesen als traumatisch erlebt werden.
- Falls Trans* Patient:innen eine Unterbringung im Einzelzimmer ablehnen, empfiehlt sich eine Besprechung im Pflegeteam über die Optionen einer gemeinsamen Zimmerbelegung. So könnte die Zusammenlegung mit einer anderen Trans*Patient:in mit gleicher geschlechtlicher Identität oder auch dieZusammenlegung mit einer Cis*Patient:in erwogen werden.
- Vor diesem Hintergrund kann Trans*Patient:innen ein entsprechendes Angebot zu ihrer Unterbringung unterbreitet und ihre Zustimmung zu einer dieser Optionen erbeten werden.
- Bevor eine gemeinsame Zimmerbelegung erfolgen kann, bedarf es immer auch der Zustimmung des/der anderen Patient:in.Die Bedürfnisse beider Patient:innen in Hinblick auf die Wahrung ihrer Intimsphäre sind zu erfragen und zu wahren (z.B. Benutzung eines Vorhangs zwischen den Betten).
Ergibt sich im Zuge einer gemeinsamen Zimmerbelegung von Trans*Patient:innen (die noch keine Transition zu dem Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren, durchlaufen haben) und Cis*-Patient:innen, dass einer/eine der Patient:innen mit der Situation überfordert ist, sollte eine Verlegung ermöglicht werden.Dadurch können Trans*patient:innen vor (neuerlicher) Diskriminierung geschützt sowie die Intimsphäre und Wünsche der anderen Patient*innen geachtet werden
Da im Kontext der medizinischen und pflegerischen Versorgung von Trans*Patient:innen häufig Unsicherheiten im professionellen Team bestehen, empfiehlt die Ethikkommission für Berufe in der Pflege Niedersachsen Teamfortbildungen zu organisieren, um Unsicherheiten abzubauen und der Stigmatisierung und Diskriminierung von Trans*Personen vorzubeugen. Im Sinne eines professionellen Umgangs mit wiederkehrenden, als ethisch herausfordernd wahrgenommenen Situationen kann es zudem hilfreich sein, sich gemeinsam (auch unterstützt durch das Klinische Ethikkomitee) auf Verfahrensregeln und standardisierte Abläufe zu einigen, die für alle Mitglieder eines Arbeitsbereichs oder einer Einrichtung verbindlich sind.
Berücksichtigung von Patient:innenwünschen bei möglicherweise entgegenstehenden rechtlichen Vorgaben (z.B. seitens Arbeitsgeber:in, Einrichtungsträger:in)
Wie kann mit Situationen umgegangen werden, in denen Pflegefachpersonen die Berücksichtigung des Wunsches von Pflegeempfänger*innen als moralisch geboten ansehen, daran jedoch durch eine (z.B. vom/von der Arbeitsgeber:in/Träger:in) angeführte Rechtsvorschrift gehindert werden? Wie können solche die Pflegefachpersonen oder auch das Verhältnis zur Leitungsebene belastenden Situationen im Team bearbeitet werden?
Die Ethikkommission für Berufe in der Pflege möchte mit Blick auf diese Fragestellungen die folgenden Punkte zu bedenken geben:
- Pflegehandlungen sind selbstverständlich an rechtliche Vorgaben gebunden. Die Existenz rechtlicher Vorgaben erübrigt jedoch nicht das ethische Abwägen von pflegerischen Handlungsmöglichkeiten im Einzelfall. Dies begründet sich insbesondere vor dem Hintergrund, dass individuelle Wünsche von Pflegeempfänger*innen Respekt verdienen, unabhängig davon, wie sie motiviert sind/begründet werden. Das Bemühen, auf individuelle Wünsche von pflegerischer Seite her soweit wie möglich einzugehen, entspricht dem pflegerischen Berufsethos.
- Bei Uneinigkeit im Team, wie mit dem Wunsch von Pflegeempfänger*innen im Lichte möglicherweise entgegenstehender rechtlicher Vorschriften umgegangen werden soll, ist eine gemeinsame Besprechung im Team oder mit den von einem Konflikt betroffenen Kolleg*innen zu empfehlen. Ziel einer solchen Besprechung ist es, sowohl die im Raum stehenden moralischen Positionen der von dem Konflikt betroffenen Personen, als auch die rechtliche/organisatorische Sachlage in den Blick zu nehmen und vor diesem Hintergrund zu einer begründeten Entscheidung, die von allen Beteiligten mitgetragen werden kann, zu gelangen. Zur Unterstützung einer solchen Besprechung im Team können vielleicht die folgenden Fragen hilfreich sein:
Klärung des Wunsches der Pflegeempfängerin/des Pflegeempfängers:
a) Worin genau besteht der Wunsch?
b) Wie wird der Wunsch begründet?
Klärung der Positionen im Pflegeteam:
a) Wie stehen die Mitglieder des Pflegeteams zu dem geäußerten Wunsch?
b) Was sind ihre Gründe, dem Wunsch der Pflegeempfängerin/des Pflegeempfängers zu entsprechen/nicht zu entsprechen?
c) Was sind die Befürchtungen der von dem Konflikt betroffenen Mitarbeitenden, wenn sie dem Wunsch der Pflegeempfängerin/des Pflegeempfängers nachkommen/nicht nachkommen?
Klärung der rechtlichen Sachlage & organisationalen Rahmenbedingungen:
a) Welche konkreten rechtlichen Vorschriften stehen dem geäußerten Wunsch einer Pflegeempfängerin/eines Pflegeempfängers entgegen?
b) Ist bekannt, wie andere Einrichtungen/Institutionen mit der konkreten, in Frage stehenden Situation umgehen?
Unterstützende Fragen zur Lösungsfindung im Team:
a) Haben sich durch die Klärung der Sachlage alternative Handlungsoptionen aufgetan?
b) Wie sind diese Handlungsoptionen mit Blick auf den Wunsch der Pflegeempfängerin/des Pflegeempfängers zu bewerten?
c) Wie sind diese Handlungsoptionen mit Blick auf die geltenden Rechtsvorschriften zu bewerten?
d) Lässt sich aus einer der im Raum stehenden Handlungsoptionen eine für alle Seiten tragbare Lösung ableiten?
e) Wer ist konkret verantwortlich für die Umsetzung der gefundenen Lösung?
f) Wer muss/soll über diese Lösung (zusätzlich) informiert werden?
Beachtung von Patientenverfügungen bei Reanimation
Viele Bewohner haben eine Patientenverfügung mit dem Vermerk, dass keine Reanimation gewünscht ist. Sind wir als Pflegekräfte dazu aufgefordert, dennoch wiederzubeleben, bis der angeforderte Notarzt eintrifft oder sind wir dazu angehalten, dem Wunsch der Patientenverfügung nachzugehen und nicht zu reanimieren?
Die Autonomie als Recht jedes Menschen, eine Behandlung zu akzeptieren oder abzulehnen, gilt auch für die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen.
Eine Reanimation ist nicht zu beginnen, wenn der ausdrückliche Wunsch der Bewohnerin oder des Bewohners dem entgegensteht. Jede Person, der dieser Wunsch bekannt ist, hat sich daran zu halten. Wiederbelebungsversuche sind zu unterlassen. Das betrifft sowohl die beruflich Pflegenden, als auch Angehörige und den angeforderten notärztlichen Dienst.
Wichtig ist, dass die Patientenverfügung eine eindeutige Willensbekundung im Hinblick auf die Reanimation enthält. Möglich ist auch, dass der zu beachtende Wunsch aufgrund von Gesprächen mit der betroffenen Person oder ihrer rechtlichen Vertretung bekannt ist.
Empfehlenswert ist eine geeignete Dokumentation, um im konkreten Einzelfall auch entsprechend dem Wunsch der Bewohnerinnen und Bewohner handeln zu können.